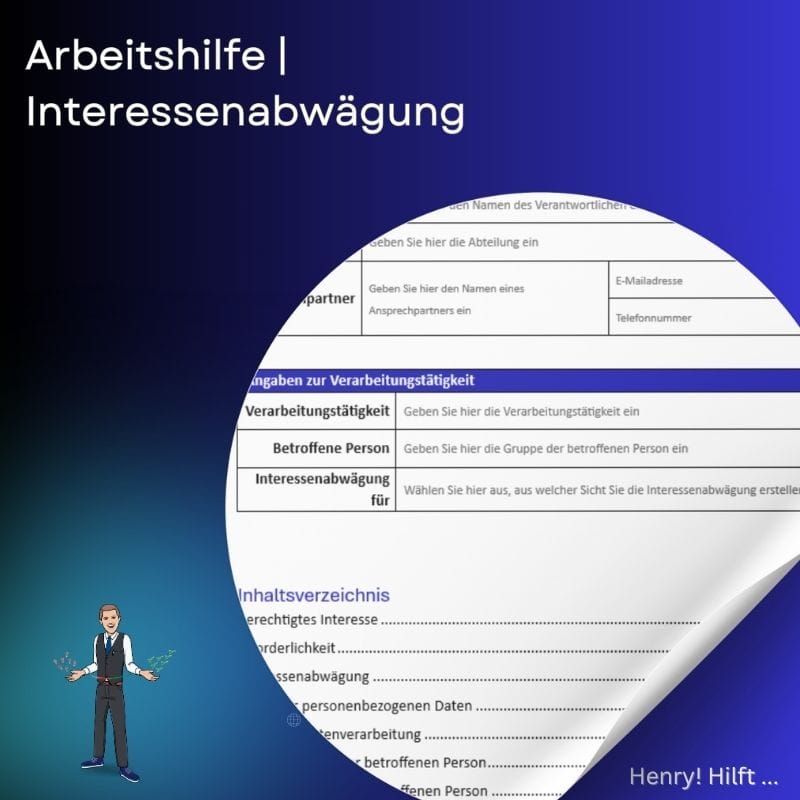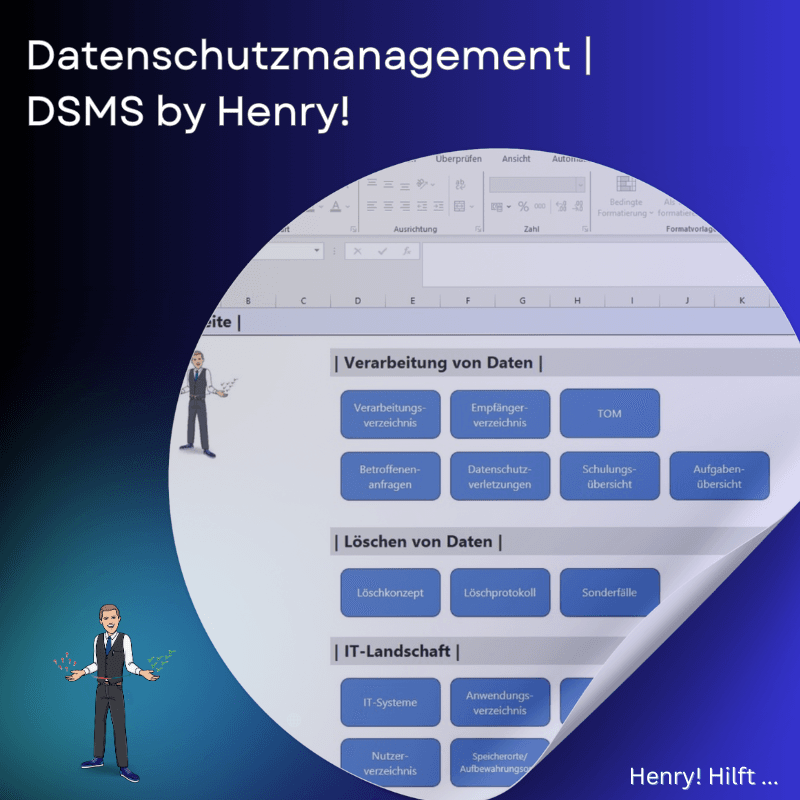Testbetrieb HR‑Software DSGVO: Was das BAG‑Urteil vom 08.05.2025 jetzt konkret verlangt
Der Testbetrieb HR‑Software DSGVO ist möglich – aber nur mit klarer Erforderlichkeitsprüfung, enger Datenliste und einer Betriebsvereinbarung, die in der Praxis gelebt wird. Das Bundesarbeitsgericht hat am 08.05.2025 (8 AZR 209/21) entschieden, dass Echtdaten im Test auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO zulässig sein könnten, wenn Dummy‑Daten den Testzweck erkennbar nicht erreichen. Zugleich hat es Grenzen aufgezeigt: Schon eine kleine Überschreitung der zulässigen Datenkategorien führte zu 200,00 € immateriellem Schadensersatz zuzüglich Zinsen seit dem 26.05.2018. Wer den Testbetrieb HR‑Software DSGVO plant, sollte deshalb von Anfang an auf Minimalprinzip, nachvollziehbare Begründung und BV‑Disziplin setzen.
Kernaussagen in 60 Sekunden
Kern der Entscheidung ist die Anerkennung, dass ein Testbetrieb HR‑Software DSGVO auf das berechtigte Interesse gestützt werden kann, wenn weniger eingriffsintensive Alternativen – etwa synthetische oder ausreichend realistische Dummy‑Daten – den Testzweck nicht erreichen. Das Gericht hat aber zugleich klar gemacht, dass die Grundsätze aus Art. 5 DSGVO den Rahmen bilden und dass schon kleine Abweichungen von einer vereinbarten Datenliste zu einem (wenn auch geringen) Schadensersatz führen können. Ergänzend betont der EuGH (Urteil vom 19.12.2024, C‑65/23), dass Kollektivvereinbarungen keine Abkürzung darstellen: Auch bei einer Betriebsvereinbarung bleiben Art. 5, Art. 6 und gegebenenfalls Art. 9 DSGVO voll anwendbar; die gerichtliche Kontrolle ist umfassend. Die Vorinstanz LAG Baden‑Württemberg (25.02.2021, 17 Sa 37/20) hatte das Bild teils anders gezeichnet, das BAG hat den Maßstab nachgeschärft und ein wichtiges Signal für die Praxis gesetzt.
Für Unternehmen bedeutet das: Ohne konkrete und schriftlich nachvollziehbare Erforderlichkeitsbegründung gibt es keinen Echtdaten‑Test. Die zulässigen Datenkategorien müssen im Vorfeld eng definiert und im Betrieb strikt eingehalten werden. Dokumentation wird zum praktischen Risikofilter: Warum genügen Dummy‑Daten nicht, welche Felder sind wirklich nötig, welche Schutzmaßnahmen sind aktiviert und wann wird gelöscht? Die schnelle Lehre lautet deshalb, dass selbst kleine Überschreitungen greifbare Folgen haben können. Der Merksatz für den Alltag: Testbetrieb HR‑Software DSGVO funktioniert nur mit Minimalprinzip, sauberer Begründung und gelebter BV‑Disziplin.
Sachverhalt
Die Parteien stritten über die Nutzung von Beschäftigtendaten im Rahmen eines Testbetriebs für eine neue HR‑Software. Die Beklagte, ein deutsches Unternehmen innerhalb eines internationalen Konzerns mit Konzernobergesellschaft in Washington, D.C., plante 2017 die konzernweite Einführung der cloudbasierten Personal‑Informationsmanagementsoftware „Workday“. Um das System zu befüllen und zu testen, lud die Beklagte zwischen dem 24. April und dem 18. Mai 2017 personenbezogene Daten aus ihrer bestehenden Personalverwaltungssoftware auf eine SharePoint‑Seite der Konzernobergesellschaft mit Serverstandort in den USA, um sie von dort nach Workday zu übertragen. Neben typischen Stammdaten wie Name, Vorname, dienstlicher Telefonnummer und dienstlicher E‑Mail wurden auch zahlreiche weitere Angaben übertragen, darunter Vergütungsdaten (Jahres‑ und Monatsgehalt, variable Anteile), die private Wohnanschrift, Geburtsdatum, Familienstand sowie Sozialversicherungsnummer und Steuer‑ID des Klägers. Der Kläger war langjähriger Mitarbeiter und zugleich Vorsitzender des bei der Beklagten gebildeten Betriebsrats.
Am 3. Juli 2017 schlossen die Beklagte und der Betriebsrat eine „Duldungs‑Betriebsvereinbarung über die Einführung von Workday“. Diese BV regelte ausdrücklich nur den vorläufigen Betrieb zu Testzwecken, untersagte eine Nutzung für operative HR‑Prozesse und sah vor, dass vor einem Produktiveinsatz eine gesonderte Betriebsvereinbarung zu schließen ist. In der Anlage 2 zur Duldungs‑BV wurde ein abschließender Datenkatalog für die testweise Nutzung festgelegt: Personalnummer, Nachname, Vorname, Eintrittsdatum, Eintrittsdatum im Konzern, Arbeitsort, Gesellschaft/Firma sowie geschäftliche Telefonnummer und geschäftliche E‑Mail‑Adresse. Die Wirkungen der Duldungs‑BV wurden mehrfach verlängert und endeten erst mit Abschluss einer endgültigen Betriebsvereinbarung im Januar 2019.
Der Kläger machte geltend, die Verarbeitung seiner Echtdaten in Workday sei – jedenfalls ab dem 25. Mai 2018 – nicht erforderlich gewesen; für die beabsichtigten Tests hätten synthetische („Dummy‑“)Daten ausgereicht. Außerdem habe die Beklagte über den in der Duldungs‑BV genannten Datenkatalog hinaus zusätzliche Kategorien wie private Kontaktdaten, Vertrags‑ und Vergütungsdetails sowie Sozialversicherungsnummer und Steuer‑ID übertragen. Zunächst hatte der Kläger auch Verstöße im Zusammenhang mit der Übermittlung auf die US‑SharePoint‑Seite und der Auftragsverarbeitung behauptet. Im Verlauf des Revisionsverfahrens beschränkte er sein Begehren jedoch ausdrücklich auf den Vorwurf der „überschießenden“ Datenverarbeitung, also auf die Verarbeitung von Daten, die von der Duldungs‑BV nicht erfasst waren.
Die Beklagte bestritt einen Rechtsverstoß und sah den Testbetrieb als zulässig an. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht wiesen den immateriellen Schadensersatzanspruch zunächst ab. Das Bundesarbeitsgericht setzte das Verfahren aus und legte Fragen zur Auslegung von Art. 88 DSGVO dem EuGH vor. Nach der EuGH‑Entscheidung vom 19. Dezember 2024 (C‑65/23) entschied das BAG am 8. Mai 2025: Ein Test mit Echtdaten kann zwar grundsätzlich auf ein berechtigtes Interesse gestützt sein, wenn Dummy‑Daten den Testzweck nicht erreichen. Im konkreten Fall war jedoch die Verarbeitung der über den BV‑Katalog hinausgehenden Daten rechtswidrig. Das Gericht sprach dem Kläger 200,00 € immateriellen Schadensersatz zuzüglich Zinsen seit dem 26. Mai 2018 zu.
Rechtlicher Rahmen & Einordnung
1) Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – berechtigtes Interesse
Die Rechtsgrundlage kann das berechtigte Interesse des Arbeitgebers sein, neue oder geänderte Systeme vor dem Produktiveinsatz belastbar zu prüfen. Dieses Interesse trägt jedoch nur, wenn die Erforderlichkeit sorgfältig belegt ist. Solange Dummy‑Daten denselben Zweck erreichen, haben Echtdaten Pause. Notwendig werden sie erst, wenn objektiv nachvollziehbare Gründe vorliegen, etwa komplexe Rollen‑ und Rechtekonzepte, abhängige Workflows über mehrere Module, Integrationen in Drittsysteme oder realistische Fehlerszenarien, die sich mit synthetischen Daten nicht zuverlässig nachstellen lassen.
„Allerdings stellt sich hier die überschießende Datenverarbeitung im Ergebnis schon deshalb als nicht erforderlich iSv. Art. 6
Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO dar, weil sie über die Erlaubnis in der BV Duldung hinausgeht“(BAG, Urteil vom 08.05.2025, Az.: 8 AZR 209/21)

2) Art. 5 DSGVO – Grundsätze
Die Grundsätze liefern die Leitplanken. Datenminimierung bedeutet, nur die Felder zu verarbeiten, die für den konkreten Testfall zwingend sind. Zweckbindung heißt, dass die Daten ausschließlich dem Testzweck dienen und nicht in operative HR‑Prozesse hineinwirken. Speicherbegrenzung verlangt einen klaren Löschstichtag, idealerweise automatisiert und nachweisbar. Integrität und Vertraulichkeit werden über angemessene TOMs gesichert – von Verschlüsselung und Rollenmodellen über Pseudonymisierung bis hin zu belastbarem Logging.
3) Art. 88 DSGVO i. V. m. § 26 BDSG – Kollektivvereinbarungen
Eine Betriebsvereinbarung kann den Testbetrieb präzise rahmen, sie senkt die DSGVO aber nicht ab. Gerichte prüfen vollumfänglich, ob Zweck, Datenliste, Zugriffsregeln, Berichtspflichten, Verbote (etwa von Leistungs‑/Verhaltenskontrollen) und Löschung mit den Grundsätzen harmonieren. Je klarer und abschließender die BV formuliert ist, desto besser lässt sich der Testbetrieb steuern – und desto geringer ist das Risiko von Ausreißern.
4) Art. 82 DSGVO – immaterieller Schadensersatz
Ein Bagatellfilter existiert nicht. Erforderlich ist ein Verstoß, ein (auch geringer) Schaden und Kausalität. Überschreitungen der BV, unklare Erforderlichkeit oder Defizite bei Löschung und TOMs sind in der Praxis die größten Risikotreiber. Der zugesprochene Betrag im entschiedenen Fall war klein, die Botschaft ist groß: Jeder Verstoß kann Folgen haben.
Praxis: So setzen Sie den Testbetrieb sauber um
In der Umsetzung bewährt sich ein schlanker, aber konsequenter Ablauf. Am Anfang steht die präzise Beschreibung des Use‑Cases: Welche Funktionen, Rollen, Schnittstellen und Reports werden geprüft und aus welchem Grund? Darauf folgt eine nüchterne Alternativenprüfung. Hier wird festgehalten, mit welchen Dummy‑ oder synthetischen Daten sich das Ziel erreichen ließe und warum das im konkreten Fall nicht genügt. Gute Gründe sind historisierte personenbezogene Abhängigkeiten, die sich nicht glaubhaft simulieren lassen, oder die Notwendigkeit, echte Fehlerbilder aus Altdaten zu reproduzieren. Bequemlichkeit, fehlende Tools oder Zeitdruck reichen nicht.
Sodann wird ein abschließender Datenkatalog definiert, der nur jene Felder enthält, die für die Testfälle zwingend sind. Typisch und oft ausreichend sind
- Personalnummer
- Name
- Eintrittsdatum
- Standort
- Gesellschaft
- geschäftliche Kontaktdaten.
Privatadressen, Steuer‑ID, Sozialversicherungsnummer, Vergütungsdetails sowie besondere Kategorien personenbezogener Daten gehören in der Regel nicht hinein. Die Betriebsvereinbarung
- beschreibt den Zweck („einmaliger Test zur Funktions‑ und Belastungsprüfung“),
- setzt einen klaren Zeitraum mit Enddatum,
- regelt Rollen und Rechte,
- untersagt Leistungs‑ und Verhaltenskontrollen,
- beschränkt Reporting auf die Funktionsprüfung und
verpflichtet auf starke technische und organisatorische Maßnahmen. Dazu zählen
- Verschlüsselung in Transit und at Rest,
- Mandantentrennung,
- Export‑Sperren,
- Wasserzeichen beim Datenexport,
- revisionssicheres Audit‑Logging,
- eine SIEM‑Anbindung,
- regelmäßige Rechte‑Reviews und
- ein Vier‑Augen‑Prinzip für privilegierte Administrationsvorgänge.
Zentral ist die Löschung: Sie erfolgt fristgebunden, automatisiert und nachvollziehbar – inklusive Backups – und wird protokolliert.
Typische Fehlerquellen lassen sich vermeiden, wenn die Datenliste als harte Leitplanke verstanden wird: Zusätzliche Felder werden nicht „kurz mitgenommen“. Testreports bleiben Testreports und werden nicht für operative HR‑Entscheidungen umgedeutet. Löschtermine sind fix, automatisiert und protokolliert. Und Logging heißt nicht nur „im Tool aktiviert“, sondern beweissicher konzipiert, mit Exportverboten und Auswertungsmöglichkeiten im Sicherheitsmonitoring.
„Die Verarbeitung personenbezogener Daten, um eine neue Personalverwaltungs-Software zu testen, kann nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers gerechtfertigt sein, sofern entpersonalisierte „Dummy-Daten“ zur Erreichung des Testzwecks nicht ausreichen.„
(BAG, Urteil vom 08.05.2025, Az.: 8 AZR 209/21)
Blueprint: Betriebsvereinbarung „Testbetrieb HR‑Software“
Ein praxistauglicher Blueprint ist schnell beschrieben. Er beginnt mit Zweck und Zeitraum: ein einmaliger, klar abgegrenzter Testbetrieb HR‑Software DSGVO zur Evaluation von Workflows und Funktionen, mit einem konkreten Beginn, einem ebenso konkreten Ende und ohne Nachwirkung, sodass ein Go‑Live nur auf Basis einer neuen Vereinbarung möglich ist.
Herzstück ist ein abschließender Datenkatalog mit wenigen Feldern wie Personalnummer, Name, Vorname, Eintrittsdatum (ggf. auch konzernweit), Arbeitsort, Gesellschaft sowie geschäftliche E‑Mail und Telefonnummer. Explizit ausgeschlossen bleiben Privatanschrift, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Steuer‑ und Sozialversicherungsnummer, Vergütungsdetails sowie Gesundheits‑ oder Religionsdaten. Die Rollen und Zugriffe sind rollenbasiert organisiert; privilegierte Administration erfolgt im Vier‑Augen‑Prinzip. Der Betriebsrat erhält Einsichts‑ und Kontrollrechte und wird geschult. Verarbeitungsgrenzen stellen klar, dass die Daten ausschließlich Testzwecken dienen, dass keine operativen HR‑Prozesse stattfinden, dass Leistungs‑ und Verhaltenskontrollen tabu sind und dass Reporting ausschließlich der Funktionsprüfung dient. Technische und organisatorische Maßnahmen sichern den Rahmen: Verschlüsselung, Mandantentrennung, Export‑Sperren, Wasserzeichen, revisionssicheres Audit‑Logging mit SIEM‑Anbindung sowie regelmäßige Rechte‑Reviews. Die Löschung erfolgt spätestens T+30 nach Testende, umfasst auch Backups und wird über ein Löschprotokoll nachgewiesen. Information und Schulung runden den Blueprint ab, und eine klare Schlussklausel verweist im Konfliktfall auf die Einigungsstelle und bestätigt das Ende ohne Nachwirkung. Ein kleiner, aber wirksamer Tipp: Benennen Sie die Vereinbarung ausdrücklich „Testbetrieb HR‑Software DSGVO“. Der Zweck springt dann ins Auge und verhindert Missverständnisse.
DSFA‑Light
Die DSFA‑Light konzentriert sich auf das Wesentliche. Sie beschreibt zunächst den Zweck, also die Prüfung von HR‑Workflows, Rollen, Schnittstellen und typischen Integrationen wie Payroll‑Export, Zeitwirtschaft oder Bewerberimport. Danach bewertet sie die Alternativen und erklärt, weshalb Dummy‑ oder synthetische Daten für die vorgesehenen Tests nicht genügen – etwa wegen komplexer personenbezogener Parametrik, modulübergreifender Abhängigkeiten oder weil reale Fehlerbilder aus Altdaten nachgestellt werden müssen. Der Datenkatalog folgt dem Blueprint und ist abschließend formuliert.
Im Abschnitt zu Empfängern und Standorten legt die DSFA‑Light fest, dass die Verarbeitung in einer internen EU/EWR‑Testumgebung erfolgt; Drittlandzugriffe werden nur zugelassen, wenn sie ausnahmsweise zwingend sind und vertraglich sowie technisch (SCC, Transfer‑Impact, zusätzliche Maßnahmen) abgesichert werden – idealerweise vermeiden Sie sie im Test vollständig. Die TOMs werden konkret benannt: starke Verschlüsselung, gehärtete Systeme, Just‑in‑Time‑ und Privileged‑Access‑Kontrollen, Deaktivierung aller Produktiv‑Integrationen, Export‑Sperren, vollständige Protokollierung aller Exporte und Downloads sowie regelmäßige Review‑Meetings. Eine klare Zeitachse strukturiert das Projekt mit Vorbereitungen bis T‑30, Start bei T‑0 und Löschung einschließlich Nachweis bis T+30. Go/No‑Go‑Kriterien machen die Entscheidung greifbar: Go bei belegter Erforderlichkeit, geschlossenem Datenkatalog und umgesetzten Maßnahmen; No‑Go bei unklarer Erforderlichkeit, offenem Katalog, fehlender Löschautomatik oder ungesicherten Drittlandübermittlungen. Der Löschtermin wird verbindlich als T+30 festgelegt und umfasst auch Backups; der Nachweis geht an DSB und Betriebsrat.
Beweisführung, die hält…
Beweissicherheit entsteht, wenn Dokumentation nicht als lästige Pflicht, sondern als Projektbestandteil verstanden wird. Die Unterlagen beantworten jederzeit, wer beteiligt ist, was genau getestet wird, wann Freigaben erfolgt sind, wo die Umgebung liegt und wie die Verarbeitung abgesichert wird. Dazu gehören eine saubere Beschreibung der Testfälle und aktivierten Module, eine klare Felderliste, die Definition zulässiger Reports und Exporte, ein Zeitplan mit Freigaben und Schaltprotokollen, Angaben zu Mandanten und Regionen, ein vollständiges Audit‑Logging aller Exporte sowie der abschließende Lösch‑Report. Ein laufender Abgleich mit der Betriebsvereinbarung stellt sicher, dass nur die zulässigen Felder genutzt werden und die Grundsätze aus Art. 5 durchgängig eingehalten sind. So sinkt nicht nur das rechtliche, sondern auch das operative Risiko.
Mythen vs. Fakten
Der verbreitete Mythos, mit einer Betriebsvereinbarung sei alles erlaubt, hält der Realität nicht stand. Eine BV schafft Sichtbarkeit, Grenzen und Kontrolle, aber keine Immunität gegenüber der DSGVO. Ebenso falsch ist die Annahme, im Test dürfe man mehr, weil es „nur Test“ sei; der Test ist ein eigener Zweck und unterliegt denselben Grundsätzen. Wer 200 Euro Schadensersatz als Peanuts abtut, verkennt das Signal: Jeder Verstoß kostet – rechtlich und reputativ. Und schließlich sind Dummy‑Daten zwar oft ausreichend und sollten der Standard sein, aber nicht immer; in den wenigen Ausnahmen braucht es eine tragfähige, vorher dokumentierte Begründung.
Mini‑Case aus der Praxis
Ein internationaler Konzern prüfte eine große HR‑Suite konzernweit. Eine Duldungs‑BV legte Zweck und eine enge Datenliste fest. Im Projektverlauf wurden jedoch zusätzliche Felder aktiviert, die über die Vereinbarung hinausgingen, teils aus Tempo, teils aus Feature‑Neugier, teils aus fehlender Kontrolle. Juristisch machte das einen kleinen, aber echten Unterschied: Der Verstoß war gering, der Schadensersatz ebenfalls, die Lehre deutlich. Hätte das Team die Datenliste als harte Leitplanke behandelt, die Umgebungen strikt isoliert und die Löschung automatisiert, hätte sich das Risiko spürbar reduziert.
30‑Tage‑Plan
Der 30‑Tage‑Plan folgt einem einfachen Rhythmus. In Woche 1 klären Sie Ziele, Module, Schnittstellen und definierst, welche Dummy‑Optionen es gibt und warum sie im Zweifel nicht reichen. Gleichzeitig entsteht ein erster Datenkatalog und eine Liste der technischen Maßnahmen. In Woche 2 wird die Betriebsvereinbarung finalisiert, die Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO dokumentiert und die DSFA‑Light gestartet; parallel richten Sie Mandant, Verschlüsselung, Export‑Sperren und Logging ein. In Woche 3 informieren Sie die Belegschaft im Intranet, schulen das Testteam und den Betriebsrat, holen die formale Freigabe ein und starten erst dann den Testbetrieb HR‑Software DSGVO. In Woche 4 machen Sie einen Abgleich der tatsächlichen Verarbeitung mit dem, was in der Betriebsvereinbarung (BV) erlaubt ist. Sie prüfen also, ob im Test genau die Zwecke verfolgt, nur die freigegebenen Datenfelder genutzt, nur die vorgesehenen Personen mit den richtigen Rechten zugegriffen, keine unzulässigen Reports/Exporte erstellt und die Löschfrist eingehalten wurde. Am Testende stoßen Sie unmittelbar nach Testende die Löschung an, berücksichtigen Backups und übergeben Lösch‑Report, Log‑Auszüge und ein Abschluss‑Memo an Datenschutzbeauftragten und Betriebsrat.
Fazit
Der Testbetrieb HR‑Software DSGVO ist kein No‑Go, aber ein eng geführtes Vorhaben. Die Kombination aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, den Grundsätzen aus Art. 5 und einer präzisen, gelebten Betriebsvereinbarung trägt, sofern Dummy‑Daten tatsächlich nicht ausreichen. Wer die Erforderlichkeit schlüssig dokumentiert, den Datenkatalog strikt beachtet, technische Maßnahmen ernst nimmt und die Löschung beweisbar umsetzt, reduziert das Risiko in der Sache und in der Außenwirkung deutlich. Als interne Vertiefung bietet sich ein Praxisleitfaden zum immateriellen Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO an; als externe Referenz eignen sich das EuGH‑Urteil vom 19.12.2024 (C‑65/23) und das BAG‑Urteil vom 08.05.2025 (8 AZR 209/21), die die Leitplanken für Testbetriebe mit Echtdaten präzise abstecken.
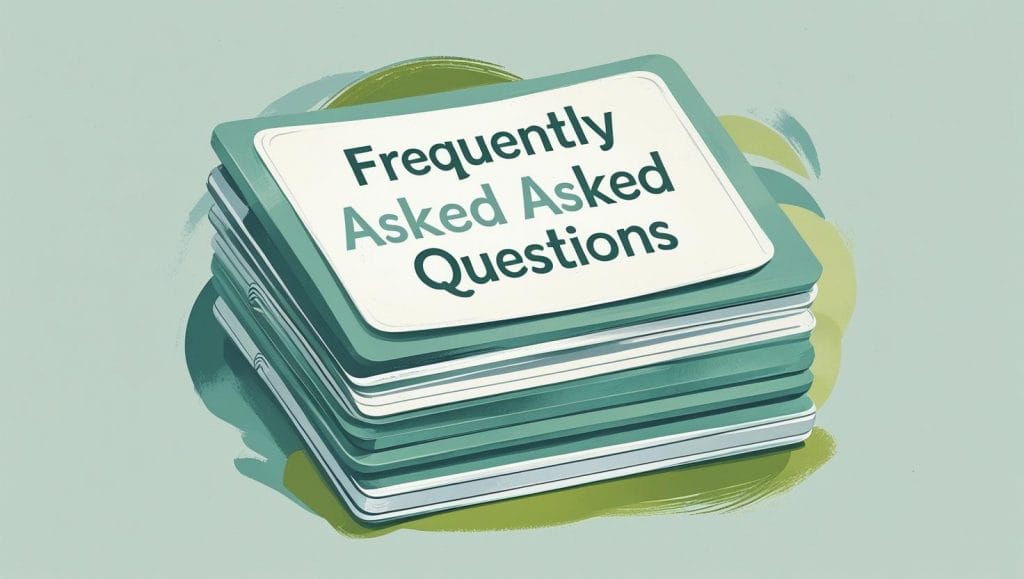
Dürfen wir Echtdaten für Lasttests oder Schnittstellen nutzen?
Grundsätzlich nur als letzte Option. Für reine Last‑/Stresstests sind Echtdaten so gut wie nie erforderlich, weil sich Volumen, Verteilungen und Fehlerquoten mit synthetischen Datensätzen realistisch nachbilden lassen. Anders kann es bei komplexen Schnittstellen‑Szenarien sein, in denen referenzielle Abhängigkeiten, historische Zustände oder modulübergreifende Berechnungen geprüft werden müssen. Dann kommt ein Einsatz von Echtdaten in Betracht, wenn Sie vorab schriftlich belegen, dass Dummy‑Daten den Testzweck nicht erreichen und weshalb.
Die Rechtsgrundlage ist regelmäßig Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, idealerweise flankiert durch eine präzise Betriebsvereinbarung zum Testbetrieb. Entscheidend ist die Minimierung: Es werden nur die für den konkreten Test zwingenden Felder verarbeitet; sensible oder komfortable Zusatzangaben bleiben draußen. Für Lasttests genügen in der Regel pseudonymisierte IDs, strukturidentische Platzhalter und realistische Wertebereiche; Namen, Privatadressen oder Vergütungsdetails braucht es dafür nicht.
Wenn Schnittstellen gegen externe Systeme getestet werden, sollten Sie zuerst mit Stubs/Mocks und synthetischen Datensätzen arbeiten. Reichen diese nicht aus, ist Pseudonymisierung Pflicht: stabile, nicht rückrechenbare Token statt Klarnamen, gesalzene Hashes für Identifikatoren, getrennte, besonders geschützte Mapping‑Tabellen mit Vier‑Augen‑Zugriff und eine isolierte EU‑Testumgebung ohne Produktiv‑Integrationen. Alle Exporte und Downloads werden protokolliert; Reporting dient ausschließlich der Funktionsprüfung und nicht operativen HR‑Entscheidungen.
Ob Echtdaten im Einzelfall nötig sind, zeigen Sie mit einem kurzen Erforderlichkeits‑Memo: Welche Testziele verfolgen Sie, welche Alternativen wurden geprüft, woran sind sie gescheitert, welche Datenspalten sind unverzichtbar und warum? Legen Sie messbare Kriterien fest (z. B. Fehlertypen, Abdeckungsgrad komplexer Workflows, Schnittstellen‑Mapping mit historischen Zuständen) und dokumentieren, dass nur mit Echtdaten diese Kriterien erreichbar sind. Danach gilt ein enger Zeitraum, eine automatische Löschfrist – idealerweise T+30 inklusive Backups – und ein belastbarer Nachweis durch Logs und Lösch‑Report.
Kurz gesagt: Ja, Echtdaten können für besondere Schnittstellen‑ oder Integrationsprüfungen zulässig sein, wenn Dummy‑Daten nachweislich nicht ausreichen. Für Last‑/Stresstests fast nie. In jedem Fall bleibt das Minimalprinzip verbindlich, und ohne saubere Dokumentation, BV‑Rahmen, starke TOMs und fristgebundene Löschung ist der Einsatz von Echtdaten nicht vertretbar.
Reicht ein allgemeiner Hinweis im Intranet?
Nein. Ein pauschaler Hinweis schafft Transparenz, macht einen Test mit Echtdaten aber nicht automatisch rechtmäßig. Er ersetzt weder die Rechtsgrundlage (typisch: berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, häufig flankiert durch eine Betriebsvereinbarung nach Art. 88 DSGVO/§ 26 BDSG) noch die Erforderlichkeitsprüfung oder eine DSFA‑Light. Er heilt auch keine inhaltlichen Fehler wie einen offenen oder überschießenden Datenkatalog.
Sinnvoll ist ein klarer, kurzer Hinweis, der den Testbetrieb HR‑Software DSGVO verständlich erklärt: Was wird getestet, in welchem Zeitraum, welche Systeme/Module sind betroffen, welche Datenkategorien werden verarbeitet (abschließend), auf welcher Grundlage erfolgt die Verarbeitung, wer hat Zugriff (inklusive Dienstleister und Standorte), wann wird gelöscht und an wen können sich Mitarbeiter mit Fragen wenden (DSB‑Kontakt). Wichtig: Der Hinweis ist keine Einwilligung; Schweigen gilt nicht als Zustimmung. Ein „Opt‑out“ ersetzt die Erforderlichkeitsprüfung nicht und macht unzulässige Datenfelder nicht zulässig.
Praktisch bewährt hat sich, den Hinweis mit einer kurzen FAQ‑Seite im Intranet zu verbinden und dort die wichtigsten Punkte zu bündeln – Zweck, Datenliste, Löschstichtag, Betroffenenrechte. Dokumentieren Sie den Veröffentlichungskanal (Startseite, Newsletter), das Datum und die Version. Halten Sie einen Screenshot oder PDF‑Export bereit, damit Sie im Abschlussbericht nachweisen können, wann und wie die Information bereitgestellt wurde.
Müssen wir den Betriebsrat beteiligen?
Ja, regelmäßig. Maßgeblich ist § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG: Sobald ein technisches System geeignet ist, Verhalten oder Leistung von Mitarbeitern zu überwachen, besteht zwingende Mitbestimmung – und zwar auch im Testbetrieb. Es genügt die Eignung; eine tatsächliche Überwachung muss nicht stattfinden. HR‑Suiten, Zeit‑ und Zutrittssysteme, Analytics‑ und Reporting‑Module oder Workflow‑Tools fallen in der Praxis fast immer in diesen Anwendungsbereich. Eine Beteiligung ist außerdem sinnvoll, weil sie Planungssicherheit schafft und spätere Diskussionen im Produktivbetrieb vermeidet.
In der Umsetzung heißt das: Der Betriebsrat wird frühzeitig informiert, noch bevor die Testumgebung live geht. Er erhält die entscheidenden Unterlagen in verständlicher Form – Systembeschreibung, Use‑Cases, begründete Erforderlichkeit von Echtdaten, abschließende Datenliste, technische und organisatorische Maßnahmen, Löschkonzept, Architektur der Testumgebung (inklusive etwaiger Drittlandbezüge), Logging‑Konzept und einen realistischen Zeitplan. Auf dieser Basis wird eine eigenständige Test‑Betriebsvereinbarung verhandelt, die Zweck und Zeitraum des Piloten, den eng gefassten Datenkatalog, Rollen und Zugriffe, Auswertungs‑ und Verwertungsverbote, Protokollierung, Nachweise und den Eskalationsweg (Einigungsstelle) regelt. Schulung und Einsichtsrechte des Betriebsrats werden benannt, ohne den Testbetrieb unnötig zu verlangsamen.
Wichtig ist der richtige Zeitpunkt: Spätestens vor dem Start der Tests braucht es die Zustimmung im Rahmen der Mitbestimmung. Ein „Test im kleinen Kreis“ ohne Beteiligung wirkt nur kurzfristig bequem, führt aber zu rechtlichen und praktischen Risiken. Der Betriebsrat kann die Nutzung untersagen oder die Einigungsstelle anrufen; Ergebnisse eines nicht mitbestimmten Tests sind politisch schwer vermittelbar und müssen oft nachträglich unter kontrollierten Bedingungen wiederholt werden.
Bei überbetrieblichen Projekten stellt sich die Frage nach der Zuständigkeit: Betrifft der Test mehrere Betriebe, liegt sie häufig beim Gesamt‑ oder Konzernbetriebsrat. Das sollte früh geklärt und im Zeitplan berücksichtigt werden. Und noch ein Punkt zur Abgrenzung: Auch wenn ausschließlich synthetische Daten genutzt werden, bleibt die Mitbestimmung regelmäßig eröffnet, sobald das System typischerweise zur Leistungs‑/Verhaltenskontrolle geeignet ist. Nur in eng gefassten Konstellationen – etwa einer vollständig isolierten Demo‑Umgebung ohne Personenbezug und ohne aktivierte Monitoring‑Funktionen – kann man über eine entfallende Mitbestimmung diskutieren; in HR‑Projekten ist das selten praxistauglich. Deshalb gilt als Best Practice: Beteiligung sauber aufsetzen, Test‑BV vorab schließen, Nachweise während des Tests fortlaufend pflegen.
Wie hoch ist das Risiko für Schadensersatz?
Spürbar – und oft unterschätzt. Das BAG hat im entschiedenen Fall 200,00 € immateriellen Schadensersatz zugesprochen, obwohl es den Testbetrieb mit Echtdaten dem Grunde nach für zulässig hielt; ausschlaggebend war die Verarbeitung „überschießender“ Daten außerhalb der vereinbarten Liste. Damit ist klar: Es gibt keinen Bagatellfilter. Schon kleine, dokumentierbare Verstöße können zu einem bezifferten Anspruch führen, zumal die Gerichte nach der EuGH‑Linie immaterielle Beeinträchtigungen wie Kontrollverlust ernst nehmen.
Die Risikohöhe hängt vor allem von einigen Hebeln ab: Je gravierender der Verstoß gegen die Grundsätze des Art. 5 DSGVO (insbesondere Datenminimierung, Zweckbindung, Speicherbegrenzung), je länger die Dauer des Tests, je größer der betroffene Personenkreis und je sensibler die Daten, desto höher das Risiko. Ein weiterer Treiber sind Drittlandbezüge ohne tragfähige Absicherung, die Missachtung einer engen Betriebsvereinbarung oder eine Erforderlichkeitsbegründung, die erst „im Nachhinein“ geschrieben wird. Auch eine breite Rechtevergabe ohne belastbares Logging erhöht das Haftungsrisiko; Vorsatz ist nicht erforderlich, einfache Fahrlässigkeit genügt.
Zur Größenordnung lässt sich sagen: In Konstellationen wie einem zeitlich begrenzten HR‑Test mit enger Datenliste und einzelnen Überschreitungen liegen zugesprochene Beträge häufig im unteren dreistelligen Bereich (der BAG‑Fall: 200 Euro, zusätzlich Zinsen ab dem 26.05.2018). Bei systematischen, länger andauernden oder besonders sensiblen Verarbeitungen kann der Betrag steigen; mit der Anzahl der Betroffenen skaliert das finanzielle Risiko zudem linear, und es kommen zumeist Verfahrens‑ und Anwaltskosten hinzu. Eine „Obergrenze“ gibt es nicht – die Gerichte schätzen nach Umständen des Einzelfalls.
Wichtig für die Anspruchsvoraussetzungen bleibt die Kette aus Verstoß, Schaden und Kausalität. Der „Schaden“ muss real, aber nicht groß sein; er kann in Gefühlen der Unsicherheit, dem Verlust der Datenkontrolle oder der Sorge vor Missbrauch liegen. Gute, zeitnahe Dokumentation hilft, Kausalität zu entkräften: Wer sauber darlegt, dass sensible Felder nicht verarbeitet wurden, dass Exporte gesperrt und Zugriffe protokolliert waren und dass rechtzeitig gelöscht wurde, reduziert die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Höhe eines Anspruchs spürbar.
Pragmatisch senken Sie das Risiko, indem Sie vor dem Start die Erforderlichkeit schriftlich belegen, die Datenliste wirklich abschließend fassen und technisch durchsetzen, Pseudonymisierung wo möglich nutzen, Reporting strikt auf die Funktionsprüfung begrenzen, eine EU/EWR‑Testumgebung ohne Produktiv‑Integrationen nutzen, alle Exporte und Downloads lückenlos loggen, die Löschung automatisieren und Nachweise (Logs, Lösch‑Report, Abschluss‑Memo) dem DSB und dem Betriebsrat zeitnah vorlegen. So entstehen aus Grundsätzen belastbare Belege – und genau die entscheiden im Streitfall über „200,00 €“ oder „kein Anspruch“.
Was ist mit Drittlandzugriffen, etwa in die USA?
Im Testbetrieb gilt die einfache Regel: Vermeiden ist besser als absichern. Jeder Zugriff aus einem Drittland – auch reiner Remote‑Support oder „nur Mitlesen“ – ist rechtlich eine Übermittlung und braucht eine tragfähige Grundlage. Für kurze, isolierte Tests ist eine reine EU/EWR‑Umgebung mit vertraglich und technisch ausgeschlossenen Drittlandzugriffen fast immer die pragmatischste Lösung.
Wenn ein Drittlandbezug unvermeidbar ist, haben Sie zwei Hauptwege.
Erstens eine Angemessenheitsentscheidung nach Art. 45 DSGVO (z. B. EU‑US Data Privacy Framework): Dann muss der konkrete Empfänger in den USA zertifiziert sein, und die Zertifizierung muss zur vertraglichen Rolle und zum Datentyp passen (insbesondere, wenn Beschäftigtendaten/„HR‑Daten“ übertragen werden). Prüfen Sie, ob der Name in der Zertifizierung exakt dem Vertragspartner entspricht, ob die Zertifizierung aktuell ist und ob sie den vorgesehenen Zweck umfasst.
Zweitens die Standardvertragsklauseln nach Art. 46 DSGVO mit einer Transfer Impact Assessment (TIA) und zusätzlichen technischen Maßnahmen. Zu diesen Zusatzmaßnahmen zählen in der Praxis vor allem starke Verschlüsselung „at rest“ und „in transit“ mit Schlüsselverwaltung ausschließlich in der EU, Zugriff nur über Just‑in‑Time‑Freigaben und pseudonymisierte Testdaten, bei denen die Zuordnungstabelle im EU‑Mandanten bleibt.
Unabhängig vom gewählten Weg sollten Sie klar zwischen Hosting/Verarbeitung außerhalb der EU und remote‑Zugriff unterscheiden. Auch ein temporärer Support‑Zugriff aus den USA auf ein EU‑System ist eine Übermittlung. Deshalb gehören in den Vertrag Sperrklauseln gegen nicht freigegebene Remote‑Sessions, ein EU‑Supportfenster (EU‑Team als erste Eskalationsstufe), Protokollierung jeder Session inklusive Bildschirmaufzeichnung, Geo‑IP/Geo‑Fence‑Kontrollen sowie eine dokumentierte Notabschaltung. Für Tests ist es zudem sinnvoll, Produktiv‑Integrationen zu kappen, Export‑Funktionen zu sperren und Daten so zu gestalten, dass selbst der Dienstleister ohne EU‑Schlüssel/Mapping nur mit Pseudonymen arbeitet.
Praktisch hat sich ein Stufenmodell bewährt: Zuerst die EU‑only‑Variante konsequent planen (EU‑Mandant, EU‑Support, Subprozessorenliste ohne Drittland), und nur wenn das objektiv nicht möglich ist, auf einen Drittlandpfad ausweichen – dann aber mit Dokumentation der Alternativen, sauberer TIA, SCC und technischer Härtung. Für Beschäftigtendaten im Test sollten Sie zusätzlich den Zeitraum kurz halten, den Personenkreis klein wählen und die Löschung inklusive Backups früh fest terminieren. Das reduziert die Angriffsfläche und damit das Risiko.
Kurz gesagt: Drittlandzugriffe im Test sind kein K.o.‑Kriterium, aber sie erhöhen Aufwand und Haftungsrisiko. Wer sie nicht vermeiden kann, braucht eine klare Rechtsgrundlage, belastbare Zusatzmaßnahmen und eine Beweisführung, die auch Monate später noch zeigt, wer wann wie zugegriffen hat – und dass am Stichtag gelöscht wurde.